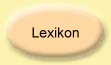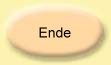Chiralitätsisomerie: optische Aktivität
Fälle 1 und 2: Zwei Enantiomere a und b
unterscheiden sich dabei nur darin, dass sie die Schwingungsebene des
polarisierten Lichts zwar um
den gleichen Betrag, aber in verschiedene Richtungen drehen.
| Dreht das Enantiomer die Schwingungsebene polarisierten Lichts im Uhrzeigersinn, nennt man es rechtsdrehend; im anderen Fall ist es linksdrehend. Dieses Phänomen wird als optische Aktivität bezeichnet. |
Spiegelbildisomere oder Enantiomere bezeichnet man deshalb auch als optische Isomere oder optische Antipoden.
Hinweis: Bisher haben wir, um die Übersicht zu wahren, so getan, als ob ein einzelnes Molekül schon für den typischen Drehwert verantwortlich wäre. In Wirklichkeit hängt der Drehwert einer Verbindung von lichtabhängigen (Wellenlänge) und stoffabhängigen Parametern (Teilchenzahl, Temperatur, Lösemittel) ab. In dieser Form könnte er an einem einzelnen Molekül also gar nicht gemessen werden.
Man zieht sich aus der Affäre, indem ein spezifischer Drehwert unter kontrollierten Bedingungen angegeben wird.
Standard ist:
- Licht der Wellenlänge lambda= 589nm (gelb, D-Linien aus dem Emissionsspektrum von Natrium)
- die molare Konzentration c(Stoff) = 1mol/l in Wasser
- Meßtemperatur T = 25°C und
- die Schichtdicke von l = 1dm (10cm!).
Fall 3: (haben wir nicht vergessen) Ein Gemisch aus gleichen Mengen von Enantiomeren einer Verbindung bezeichnet man als Racemat.